| Sprache Literatur Musik Glaube |
| Sprache Literatur Musik Glaube |
Buchbesprechung
|
|
Roger Liebi:
Herkunft und Entwicklung der Sprachen Linguistik contra Evolution Holzgerlingen (Hänssler) 2003 304 Seiten. ISBN 3-7751-4030-1. EUR 12,95 |
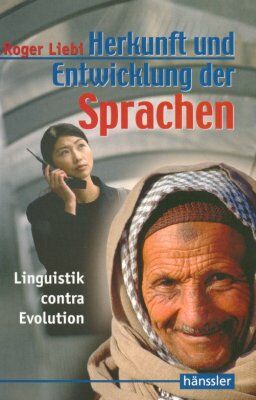 |
Über das Verhältnis zwischen Evolutionslehre und Sprachgeschichte hat Roger Liebi bereits 1991 ein Buch vorgelegt (Der Mensch – ein sprechender Affe?, Schwengeler-Verlag). Dieses Buch ist jetzt – in erheblich erweiterter Form (304 gegenüber 98 Seiten), mit geändertem (sachlicherem) Titel und in einem anderen Verlag (in Zusammenarbeit mit der Studiengemeinschaft Wort + Wissen) – neu erschienen. Aufbau und gedankliche Gliederung blieben im Wesentlichen erhalten (viele, wenn nicht die meisten Passagen des 1991er Buches wurden wörtlich übernommen); eine Reihe von Themenbereichen werden jedoch jetzt wesentlich breiter ausgeführt. Ganz neu hinzugekommen ist ein Kapitel über das Sprachenreden im Neuen Testament.
Liebis Hauptthese lautet: „Die empirisch feststellbaren Fakten der modernen Linguistik widersprechen den evolutionistischen Theorien über den Ursprung der menschlichen Sprachen. Im Gegensatz dazu harmonieren diese real beobachtbaren Tatsachen ausgezeichnet mit den biblischen Aussagen bezüglich der Herkunft des Phänomens ‚Sprache‘“ (S. 35).
Bevor der Autor den Nachweis für diese These antritt, gibt er zunächst eine Einführung in das Phänomen der Sprache generell und in die Arbeitsweisen der Linguistik. Sprachen als Codesysteme, Sprache und Denken, Sprachbeschreibung auf den Ebenen Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik und Graphemik, Spracheinteilung und Sprachtypologie – das sind einige der Themen, die Liebi in knapper Form abhandelt (S. 37–90). Danach werden die evolutionistische und die biblische Vorstellung vom Ursprung der Sprachen einander gegenübergestellt (S. 91–148). Der Autor zeigt, dass das Evolutionsmodell auf diesem Gebiet nur Spekulationen zulässt, die kaum überzeugen können und wissenschaftstheoretisch letztlich wertlos sind (Sprachentstehung durch Tierlautnachahmung, Schmerzlaute, rituelle Tänze, Gesänge usw.). Im Rahmen des biblischen Alternativmodells geht Liebi zunächst kurz auf die Erschaffung des Menschen und dann ausführlich auf den Turmbau zu Babel ein, in dem die menschliche Sprachenvielfalt nach dem Zeugnis der Bibel ihren Ursprung hat. Der Bericht in 1Mo 11 wird detailliert erläutert, in seinen biblischen und historischen Kontext eingeordnet und mit Sprachenverwirrungs- und Turmbauerzählungen aus anderen Kulturen verglichen.
Den eigentlichen Hauptteil des Buches bilden drei empirische Untersuchungen zu der Frage, ob sich im Laufe der menschlichen Sprachgeschichte eine Komplexitätszunahme (wie es das Evolutionsmodell fordern würde) oder eine Komplexitätsabnahme feststellen lässt. Liebi wählt hierzu den Bereich der Morphologie (Formenlehre) aus, da dieser – anders als Lexik, Semantik und Syntax – kaum durch bewusste menschliche Eingriffe verändert werden kann. Sollte es hier zu Wandelerscheinungen im Sinne einer Komplexitätsabnahme kommen, wäre die biblische Lehre von der Vergänglichkeit der gesamten Schöpfung (Röm 8,20) auch für die Sprache bestätigt.
In der ersten Untersuchung (S. 163–186) weist Liebi nach, dass die ältesten überlieferten Sprachen der Welt (Sumerisch, Akkadisch und Ägyptisch) morphologisch wesentlich komplexer waren als unsere heutigen Sprachen. Zum Vergleich werden Beispiele aus dem Deutschen und dem Englischen herangezogen. Auch die sog. Eingeborenensprachen sind, wie die zweite Untersuchung (S. 187–202) herausarbeitet, alles andere als primitiv, sondern weisen oft morphologische Kategorien auf, die in den abendländischen Sprachen völlig unbekannt sind. Zwischen der Kulturstufe eines Volkes und der Struktur seiner Sprache besteht demnach kein Zusammenhang. Die dritte Untersuchung (S. 203–225) belegt schließlich, dass in allen diachron erforschbaren Sprachen im Laufe der Zeit eine Abnahme der morphologischen Komplexität stattgefunden hat; hierzu werden Beispiele aus den verschiedensten Sprachstämmen erörtert. Damit kann die evolutionistische Auffassung von der allmählichen Aufwärtsentwicklung der Sprache von primitivsten Anfängen zu einem hochkomplexen System als widerlegt gelten, während die biblische Auffassung sich sehr gut mit den Untersuchungsergebnissen vereinbaren lässt. Mögliche Einwände hiergegen nimmt der Autor in einem eigenen Kapitel vorweg (S. 227–240) und entkräftet sie.
Das neu eingefügte Kapitel zum Sprachenreden im NT (S. 241–270) geht von der These aus, dass es zwischen dem Sprachenreden in Apg 2 und dem in 1Kor 12–14 keinen Unterschied gibt; es habe sich um eine übernatürliche Gabe Gottes gehandelt, die Menschen dazu befähigte, in realen Fremdsprachen, die sie nicht gelernt hatten, bewusst und nüchtern das Wort Gottes zu verkündigen, und zwar in erster Linie zu dem Zweck, den Juden zu zeigen, dass Gott jetzt in allen Sprachen zu allen Völkern rede. Nach einigen Jahrzehnten sei diese Gabe jedoch abgeklungen; das heute in charismatischen Kreisen praktizierte ekstatische „Zungenreden“ habe mit dem biblischen Sprachenreden nichts zu tun.
Am Ende des Buches fasst der Autor seine Ergebnisse noch einmal thesenartig zusammen (S. 271–276) und stellt sie in einen biblisch-evangelistischen Zusammenhang (S. 277–288). Ein Literaturverzeichnis (S. 289–299) und ein Glossar (S. 300–303) runden die Arbeit ab.
Liebis Buch beeindruckt (wie schon die Erstfassung von 1991) durch einen originellen Forschungsansatz, eine enorme Detailkenntnis und eine in ihren Hauptlinien durchweg überzeugende Argumentation. Es ist sehr erhellend zu sehen, dass auch ein scheinbar so fern liegendes Gebiet wie die Linguistik Argumente gegen die Evolutionstheorie liefern kann. Aber auch als rein linguistische Arbeit bietet Liebis Buch interessante neue Erkenntnisse: Dass z.B. Sprachwandel auf morphologischer Ebene wegen seines unkreativen Charakters grundsätzlich anders einzuordnen ist als Sprachwandel auf lexikalischer, semantischer oder syntaktischer Ebene, wurde in der Linguistik bisher wenig beachtet (S. 205). Sehr überzeugend gelingt Liebi die Kritik an evolutionistischen sprachhistorischen Konzepten, z.B. an dem August Schleichers (S. 221–223). Überraschend, aber dennoch einleuchtend ist die Erkenntnis, dass die leichte Erlernbarkeit einer Sprache (wie z.B. des morphologisch sehr einfachen Neuenglischen) nicht grundsätzlich eine positive Eigenschaft sein muss: In 1Mo 11 bestand der Sinn der Sprachenverwirrung gerade darin, „schwer überwindbare Barrieren zu bilden, um die nachsintflutliche Gesellschaft zu zwingen, sich in verschiedene Stämme und Völker aufzuspalten und sich über den Globus hinweg zu verteilen“ (S. 237). Ein sehr bedenkenswertes linguistisches Argument weiß Liebi auch gegen das sog. Zungenreden anzuführen: Im Gegensatz zu allen „echten“ Sprachen gehen dem Zungenreden prosodische Elemente wie Intonation und Akzent völlig ab (S. 255).
Natürlich kann es bei einem so umfangreichen und ungewöhnlichen Buch nicht ausbleiben, dass einzelne Fragen offen bleiben. Einige, die sich mir beim Lesen gestellt haben, möchte ich im Folgenden auflisten. Sie betreffen durchweg Detailaspekte, nicht den Hauptgang der Argumentation.
S. 51f.: Phonologische Erscheinungen werden von Liebi nicht berücksichtigt, da es vom Blickwinkel abhänge, ob man die Anzahl der Phoneme positiv oder negativ beurteilen wolle. Phonologischer Wandel muss aber nicht nur das Phoneminventar einer Sprache betreffen, sondern kann sich auch in der Silbenstruktur zeigen, die als lineare Abfolge von Segmenten durchaus Ähnlichkeiten mit der Morphologie aufweist. Hier scheint z.B. das heutige Deutsch einen deutlich höheren Komplexitätsgrad zu besitzen als die meisten der historischen und „primitiven“ Sprachen, an denen Liebi seine Untersuchungen durchführt: Die meisten von ihnen zeigen fast ausschließlich einfache Silbenstrukturen vom Typ CV oder CVC (z.B. S. 194), während im Deutschen Strukturen bis hin zu CCCVCCCC (pfropfst) oder CCVCCCCC (schrumpfst) möglich sind.
S. 163ff.: Ein Hinweis, wie man den Lautwert der logographischen Schriftzeichen untergegangener Sprachen rekonstruieren kann, wäre wünschenswert gewesen.
S. 194f.: Der Wortbegriff wird m.E. nicht genügend problematisiert. Ist die Klassifikation eines Morphems als frei oder gebunden nicht auch von Konventionen abhängig? Würden die Sprecher des Ketschua ein Morphem tatsächlich als gebunden erkennen? Würden sie die Wortgrenzen genau dort ansetzen, wo der abendländische Linguist sie ansetzt?
S. 197 u.ö.: Obwohl der Autor mehrmals beteuert, hohe morphologische Komplexität sei nicht per Definition „gut“ und niedrige „schlecht“ (z.B. S. 234), entsteht bei seinen Vergleichen doch immer wieder dieser Eindruck. Man muss sich allerdings auch fragen, ob das nicht unvermeidlich ist, wenn man die biblische Verfallslehre (Röm 8,20) auf die Sprache anwendet.
S. 235, Fußn. 461: Hier behauptet Liebi, die hebräische Dichtung sei im Gegensatz zur abendländischen nicht durch Redundanz, sondern durch Sparsamkeit der Worte gekennzeichnet. Aber ist nicht der für die hebräische Poesie so typische synonyme Parallelismus ein Paradebeispiel für Redundanz?
S. 236: Im Zusammenhang mit der Frage, wie unkreativer Sprachwandel entsteht, wäre eine Auseinandersetzung mit der heute sehr einflussreichen Sprachwandeltheorie von Rudi Keller („unsichtbare Hand“) möglich und sinnvoll gewesen.
S. 243, 249, 265: Warum das Pfingsten von Apg 2 ausgerechnet auf das Jahr 32 n.Chr. datiert wird, bleibt unklar.
S. 253, 258f., 265f.: Das Sprachenreden scheint sich nach Liebi ausschließlich an Menschen gerichtet zu haben. Die Verse 1Kor 14,2 („wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott“) und 1Kor 14,14 („wenn ich in einer Sprache bete“) zitiert er zwar, aber er geht nicht darauf ein, ob es neben dem eigentlichen Sprachenreden somit auch noch ein besonderes Sprachengebet gab.
S. 255: Leider werden die Vertreter der Auffassungen, die Liebi im Kapitel über das Sprachenreden kritisiert bzw. widerlegt, nicht mit Namen genannt; der Hinweis, dass eine bestimmte Ansicht „manchmal“ vertreten werde, ist in einer Arbeit mit wissenschaftlichem Anspruch (vgl. Vorwort, S. 25) nicht ausreichend.
S. 283: Wenn die Sprachen der Bibel (Hebräisch, Aramäisch und Griechisch) hier als „göttlich“ bezeichnet werden, um sie gegen den Vorwurf der Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit in Schutz zu nehmen, kann sich dies eigentlich nur auf ihren Ursprung beziehen; als sie zum Medium wurden, in dem das Wort Gottes niedergeschrieben wurde, waren auch sie bereits seit längerer Zeit dem „Verfall“ bzw. der „Vergänglichkeit“ (nach Röm 8,20, wenn man Liebi folgen will) unterworfen.
Die Vielzahl von Sprachen, die Liebi in seinem Buch behandelt, bringt es mit sich, dass wahrscheinlich kein Leser in allen Punkten „mitreden“ kann. Aber auch vom Autor selbst kann man nicht erwarten, dass er auf allen Teilgebieten gleichermaßen Experte ist. Liebis Stärken liegen ganz offensichtlich im Bereich der hamito-semitischen Sprachen, die er studiert hat; hier schöpft er gewissermaßen aus dem Vollen, beweist breite Literaturkenntnis, argumentiert souverän und geht z.T. auf Detailfragen ein, die für Laien völlig unverständlich sind (z.B. S. 210f., Fußn. 424). In anderen Bereichen ist er dagegen in hohem Maße auf die Forschungen anderer angewiesen, die er noch dazu in recht sparsamer Auswahl und oft sekundär zitiert. Dies gilt z.B. für die Indianersprachen, die modernen abendländischen Sprachen und auch für die neuere theoretische Linguistik. Hier zitiert er aus Lexika und populären Darstellungen anstatt aus den originalen Forschungsarbeiten (z.B. S. 94, Fußn. 138; S. 125, Fußn. 236), zieht obskure Nachschlagewerke wie Neues Lexikon (Zürich 1965) oder Der Neue Reader’s Digest Brockhaus (Stuttgart u.a. 1973) heran oder beruft sich gar auf persönliche Mitteilungen von Kollegen (S. 51, Fußn. 55; S. 63, Fußn. 85), obwohl er die betreffenden Informationen zweifellos auch in der wissenschaftlichen Literatur hätte finden können. Gerade auf dem Gebiet der germanistischen Linguistik ist seine Literaturkenntnis offenbar recht begrenzt; zum Deutschen führt er lediglich die beiden Sammeldarstellungen The World’s Major Languages (hrsg. von B. Comrie, 1989) und Die Sprachen der Welt (von F. Bodmer, 1955) an (S. 217f.). Es kann mithin nicht überraschen, dass es hier und da Aussagen gibt, die der Korrektur oder Modifikation bedürfen. Ich nenne hier einige Punkte insbesondere aus dem Bereich der allgemeinen und germanistischen Linguistik, die mir beim Lesen aufgefallen sind.
S. 50, 73: /w/ ist kein Phonem des Deutschen, /G/ ist überhaupt kein Phonem.
S. 50, 56, 57: Nicht nur „die meisten“ Phoneme tragen keine Bedeutung, sondern alle; das Phonem ist eine rein formale, lautliche Kategorie ohne Inhaltsseite (also kein sprachliches Zeichen). Wenn ein Phonem eine Bedeutung zu haben scheint (wie z.B. das Plural-e in Fische, S. 57), liegt dies daran, dass es gleichzeitig Morphem ist; nur als Morphem hat es Bedeutung, als Phonem niemals.
S. 51: Es gibt durchaus Sprachen mit mehr als 100 Lauten; die phonemreichste Sprache der Welt, das afrikanische !Xu, hat insgesamt 141 Phoneme (siehe z.B. David Crystal: Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache, Frankfurt / New York 1995, S. 165).
S. 52: Die Formulierung „An welcher Stelle berühren die Lippen und die Zunge andere Körperregionen“ ist leicht irreführend; es kann sich allenfalls um Mundregionen handeln (nicht etwa um Hände oder Füße!).
S. 53, Fußn. 63: Es muss heißen „Summer Institute of Linguistics“, nicht „for Linguistics“.
S. 57: Zu den flektierbaren Wortarten gehören außer den drei hier genannten auch noch Pronomen und Artikel (in der traditionellen Schulgrammatik außerdem noch Numeralia).
S. 58: Die hier gegebene wörterbuchbezogene Lexemdefinition ist recht fragwürdig; man sollte eher von einer Grundeinheit des mentalen Lexikons (Ebene der Langue) sprechen, die auf der Ebene der Parole durch eine bestimmte Menge von Wortformen realisiert werden kann.
S. 60, 239: Die umgangssprachliche Verwendung des Wortes Begriff im Sinne von Ausdruck sollte in einer wissenschaftlichen Arbeit vermieden werden; linguistisch ist Begriff genau das Gegenteil von Ausdruck, nämlich das gedankliche Konzept, der Inhalt, die Bedeutung.
S. 63, 126, 241: Liebis Neudefinition der Termini Oberflächenstruktur und Tiefenstruktur wird zwar wiederholt auf Chomsky bezogen, hat mit Chomskys Definition aber im Grunde nichts zu tun; bei Chomsky handelte es sich um Strukturen von Sätzen, bei Liebi dagegen um Strukturen der gesamten Sprache einschließlich der Sprachfähigkeit. Der mehrmals geäußerte Vorbehalt, Chomskys Termini seien inzwischen veraltet, ist zwar an sich richtig, in Anbetracht von Liebis Neudefinition aber letztlich nicht nötig.
S. 124: Übersetzen ist kein geeignetes Beispiel für Mehrdeutigkeit (Polysemie). Es handelt sich um zwei verschiedene Wörter mit unterschiedlichem Betonungsmuster (über'setzen vs. 'übersetzen), also nicht einmal um Homonyme, sondern lediglich um Homographe.
S. 152, 155: Adelung hieß mit Vornamen Johann Christoph, nicht Christian.
S. 184: Hier wird Hochdeutsch umgangssprachlich im Sinne von Standarddeutsch verwendet. In der Germanistik ist Hochdeutsch ein Oberbegriff für das mitteldeutsche und das oberdeutsche Dialektgebiet; das von Liebi angesprochene Alemannisch ist somit ein hochdeutscher Dialekt.
S. 204: In der Bezeichnung „Neo-Grammatiker“ zeigt sich Liebis Abhängigkeit von der englischsprachigen Literatur (“neo-grammarians”); richtig wäre „Junggrammatiker“. Was Leonard Bloomfield betrifft, so studierte er zwar in Leipzig bei den Junggrammatikern, ist aber selbst dem Strukturalismus und dem Behaviorismus zuzuordnen.
S. 251: Der Herausgeber des Metzler Lexikons Sprache heißt Helmut, nicht Herbert Glück.
S. 300: Die Übersetzung von Ablativ mit „Durchfall“ dürfte wohl kaum ernst gemeint sein.
S. 300, 302: Die Definitionen von Affix und Suffix sind vertauscht und zudem recht ungenau: Affixe sind keine beliebigen Morpheme, sondern stets gebundene grammatische Morpheme; außerdem können sie nicht nur vorn oder hinten, sondern auch vorn und hinten (Zirkumfix, z.B. das deutsche Partizip-Perfekt-Zirkumfix ge-t in ge-frag-t) an ein Morphem angehängt oder in ein Morphem eingefügt werden (Infix, nicht im Deutschen).
S. 301: Infixe werden, wie soeben erwähnt, nicht einfach in ein Wort (das ja auch aus zwei oder mehr Morphemen bestehen kann) eingeschoben, sondern in ein einzelnes Morphem, das dadurch diskontinuierlich wird.
ebd.: „Parole“ ist weniger ein einzelner Sprechakt als die Gesamtheit der Produkte der Realisierung der „Langue“. Ein einzelner Satz ist nicht „eine Parole“, sondern „eine Äußerung (auf der Ebene) der Parole“.
Einige dieser Fehler und Ungenauigkeiten hätten sich beim Lektorieren leicht finden lassen müssen; die Durchsicht der Linguistin Prof. Dr. Ursula Wiesemann (Vorwort, S. 25) kann nicht besonders sorgfältig gewesen sein. Ähnliches gilt für die zahlreichen sprachlichen Fehler, die offenbar keinem Lektor aufgefallen sind; fast auf jeder Seite finden sich Kommafehler, hinzu kommen Kasusfehler (z.B. Subjekt im Akkusativ, S. 66f.; Objekt im Nominativ, S. 189), Genusfehler („ein Partikel“, S. 70; „der Verdienst“, S. 204), Numerusfehler (Subjekt und Verb inkongruent, z.B. S. 74, 223, 254, 271) und Flexionsfehler („dem Mensch“, S. 67, Fußn. 91). Je nachdem wie viel Wert man auf formale Korrektheit legt, können solche Verstöße – gerade in einem Buch über Sprache – den positiven Gesamteindruck durchaus trüben. Auch stilistisch ist das Buch leider kein Meisterwerk; durch die vielen Unterkapitel (das Inhaltsverzeichnis umfasst nicht weniger als 12 Seiten) wirkt es streckenweise recht unzusammenhängend (was zum Teil daran liegen mag, dass der Autor vom Grundgerüst des 1991er Buches ausging und es durch neue Abschnitte „auffüllte“); immer wieder beginnen Absätze mit der gezwungensten und unnatürlichsten aller Überleitungen: „In diesem Zusammenhang muss auch noch darauf hingewiesen werden ...“. Störend wirken ferner Redundanzen (bei der Definition von Synchronie auf S. 39 wird dreimal hintereinander dasselbe gesagt; S. 62: „in der Lage ... beherrschen zu können“; S. 92, 205: „bereits schon“) und andere stilistische Ungeschicklichkeiten (z.B. S. 65: „Zudem sind gewisse Fälle ... oftmals recht selten“; der erste Satz von S. 31 würde, wenn man die grammatisch nicht notwendigen Nebensätze wegließe, lauten: „Die Thematik ist kein Thema“). Auch umgangssprachliche Ausdrücke wie „rüber“ (S. 59), „Gebabbel“ (S. 67, Fußn. 91) oder „wie man so schön sagt“ (S. 69) sind dem Niveau einer wissenschaftlichen Arbeit eher abträglich.
Im Literaturverzeichnis fällt auf, dass 15 Titel an der falschen Stelle im Alphabet eingeordnet sind (Bimson, Boyd, Brockhaus, Gaebelein, Grein, Hetzron, Kontzi, Lidell, Linnenkugel, Mallinson, Moscati, Pinsker, Schenkel, Watson, Wiesemann); bei Andree fehlt der Erscheinungsort, bei Bodmer, Gukch, Ouweneel (1978) und Pailer fehlen die Vornamen, bei Schleicher beides. Im Glossar sind die Termini Präsens und Präsens-Futur doppelt aufgelistet (beim Präsens-Futur mit leicht abweichender Definition).
Dem Buch sind 21 Abbildungen beigegeben, von denen allerdings ein Drittel (Nr. 1, 3, 4, 5, 14, 19, 21) wenig bis nichts Erhellendes zum Inhalt beiträgt. So findet man drei Abbildungen von Affen, eine von einem Papagei, eine vom Sohn des Autors, eine vom Autor selbst (vor einer ägyptischen Pyramide) und eine moderne Luftaufnahme des Jerusalemer Tempelbergs. Einige der übrigen Abbildungen sehen wie schlecht gescannt aus (Abb. 6, unnummerierte Abb. S. 151, Abb. 11, 12, 13); im Buch von 1991 waren sie zum Teil in besserer Qualität abgedruckt. Drucktechnische Mängel finden sich in den ersten Kapiteln auch im Text: Hier sind zahlreiche Buchstaben beschädigt (ein besonders deutliches Beispiel: Auf S. 85, Z. 11 von unten, fehlt das zweite a von „Tatsache“ fast ganz).
Fazit: Von manchen Schwächen im Detail abgesehen, handelt es sich hier um ein sehr anregendes, in seinem Hauptanliegen absolut überzeugendes Buch, das jedem an der Thematik Interessierten empfohlen werden kann.
Michael Schneider
[zuerst in: Mailingliste APOLLOS, 11. August 2003]